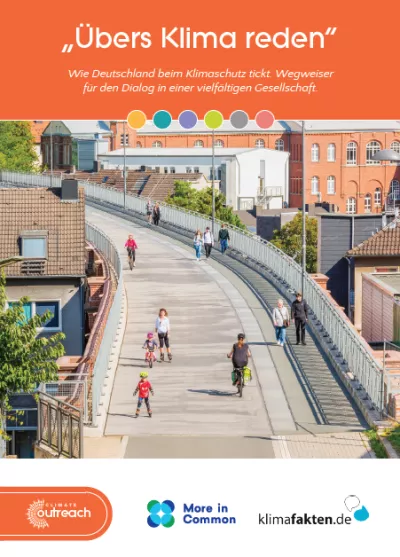Von Konservativen, Liberalen und Libertären wird Klimaschützern häufig vorgeworfen, sie würden den Menschen und der Wirtschaft ihre Freiheit nehmen wollen und eine Öko-Diktatur anstreben. Am entgegengesetzten Ende des Meinungsspektrum ist gelegentlich die Ansicht zu hören, demokratische Gesellschaften und Regierungen seien nicht fähig, das Klima zu schützen - weil sie auf zu viele Einzelinteressen Rücksicht nehmen müssten und demokratische Politiker nur auf die nächste Wahl schielen würden.
In der Zeitschrift Foreign Policy hat der kalifornische Ökonom Robert Looney die empirische Grundlage solcher Debatten einem genauen Blick unterzogen. Er glich weltweite Daten zu den demokratischen Standards in Nationalstaaten mit den Daten zu ihren Energieversorgungssystemen ab - von Ländern mit hohem Niveau wie Norwegen und der Schweiz bis zu den Schlusslichtern in Sachen Demokratie (Nordkorea) und Energieversorgung (Südafrika). Das eindeutige Ergebnis: Demokratie und Klimaschutz seien nicht nur kompatibel - Demokratie sei sogar die beste Regierungsform, um das Klima zu schützen. (Der Eindruck vom Versagen demokratischer Regierungen werde durch wenige, aber bekannte Länder wie die USA oder Australien geprägt.)
"Es zeigt sich, dass Demokratien mit viel größerer Wahrscheinlichkeit als autoritäre Regime eine Priorität auf ökologische Nachhaltigkeit legen. Dieser Fakt erscheint kontra-intuitiv", schreibt Looney. "Doch die Folgen des Klimawandels sind bereits zu spüren - in der Form schwerer Stürme, zerstörerischer Dürren, sinkender Ernteerträge und zunehmender Überflutungen. Und Wähler, deren Leben und Lebensgrundlagen immer stärker vom Klimawandel betroffen sind, fordern in wachsendem Maße, dass Politiker darauf reagieren - und zwingen sie so zu längerfristigem Denken."
tst