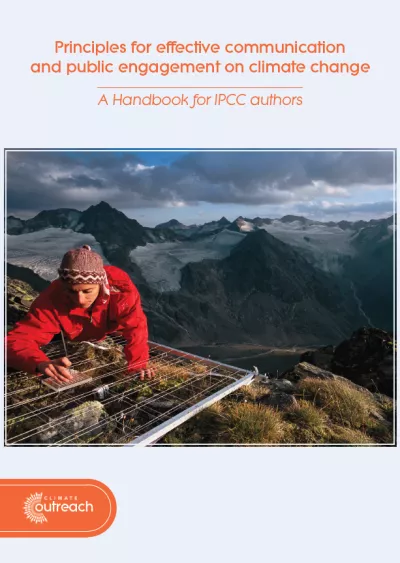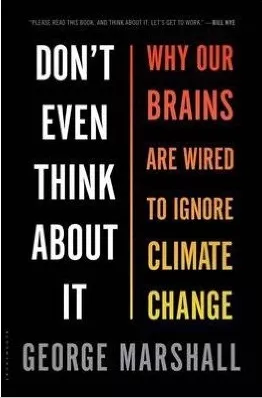Die Vermittlung ausschließlich von Informationen sei nicht der richtige Weg, um Menschen von der Gefahr des Klimawandels zu überzeugen oder sie zum Handeln dagegen zu bewegen. Das ist die Quintessenz eines Beitrags von Christopher Schrader in der Süddeutschen Zeitung. Klimaschützer müssten allen sozialen Gruppen die Gelegenheit geben, ihren eigenen Zugang zum Thema Klimawandel zu finden, zitiert er zum Beispiel den Briten George Marshall. Er hat lange für Greenpeace gearbeitet und die Organisation Climate Outreach mitgegründet. Diese erprobt neue Strategien, um zum Beispiel auch mit Konservativen konstruktiv über den Klimawandel zu kommunizieren. Die Diskussion solle mit Werten wie Sicherheit und Verantwortung beginnen, nicht mit Zahlen, meint Marshall.
Unsere Wertvorstellungen filtern nämlich die Informationen, die wir wahrnehmen, betont der Norweger Per Espen Stoknes. Wenn wir dem Überbringer einer Botschaft nicht vertrauen, könne er uns mit noch so vielen Informationen füttern - wir würden ihm trotzdem nicht glauben. Und Wissen heiße dann noch lange nicht handeln. Selbst die Menschen, die den Klimawandel als Realität erkannt haben, verändern nicht unbedingt ihr Verhalten. Dafür bräuchte es eine kulturelle Transformation, ähnlich wie beim Kampf gegen die Rassentrennung in den USA, nennt Christopher Schrader ein Beispiel.
Was Menschen zum Handeln bringt, hat der Psychologe Daniel Gilbert von der Harvard University schon vor Jahren in einem Essay geschrieben. Demnach reagieren Menschen stark auf Ereignisse, die ihre Wertvorstellungen verletzen und plötzlich geschehen. Das ist beim Klimawandel nicht der Fall, weshalb er im Gehirn eben keinen Alarm auslöse. In der Klimadebatte müsse aber ein Weg gefunden werden, "das fühlende Gehirn anzusprechen", so George Marshall.
sue