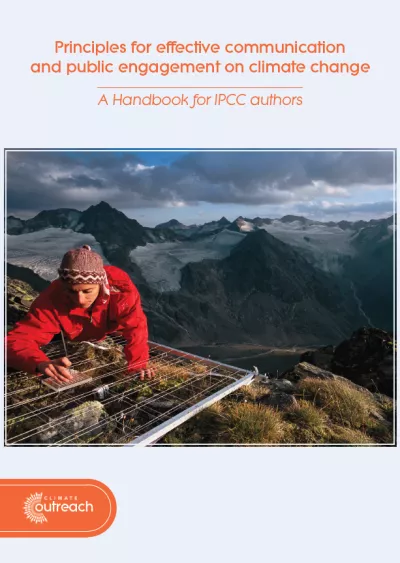Prof. Dr. Harald Welzer ist Sozialpsychologe und Soziologe, lehrt an der Europa-Universität Flensburg und an der Universität Sankt Gallen. Außerdem leitet er die Stiftung FuturZwei, die sich seit einigen Jahren mit erfolgreichen und interessanten Nachhaltigkeitsprojekten beschäftigt und darüber "Geschichten des Gelingens" erzählt. In seinen zahlreichen Publikationen hat er sich u.a. mit dem Klimawandel, sozialen Effekten, schwindenden Ressourcen und dem Raubbau an der Zukunft beschäftigt
Prof. Dr. Harald Welzer ist Sozialpsychologe und Soziologe, lehrt an der Europa-Universität Flensburg und an der Universität Sankt Gallen. Außerdem leitet er die Stiftung FuturZwei, die sich seit einigen Jahren mit erfolgreichen und interessanten Nachhaltigkeitsprojekten beschäftigt und darüber "Geschichten des Gelingens" erzählt. In seinen zahlreichen Publikationen hat er sich u.a. mit dem Klimawandel, sozialen Effekten, schwindenden Ressourcen und dem Raubbau an der Zukunft beschäftigt
"Der Meeresspiegel könnte bis zum Jahr 2300 um vier Meter steigen, selbst wenn die Politiker im frühen 21. Jahrhundert alles richtig machen. Das Anschwellen der Ozeane lasse sich nicht so schnell bremsen, wie der Anstieg der Lufttemperatur, erklärt eine Gruppe von Klimaforschern, die mit Hilfe ihrer Computer fast 200 Jahre in die Zukunft geschaut haben. […] Bei der ehrgeizigeren Politik, die die Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzt, dürften die Meere um insgesamt 1,5 Meter anschwellen. Der Anstieg würde bis zum Jahr 2300 zum Stillstand kommen. Die Zwei-Grad-Politik hätte hingegen zur Folge, dass die Ozeane um 2,7 Meter steigen. Werte zwischen 1,6 und 4,0 Metern wären auch möglich. Außerdem würde sich der Meeresspiegel im Jahr 2300 immer noch gut doppelt so schnell erhöhen wie heute, ein Ende wäre nicht in Sicht." So fasste die Süddeutsche Zeitung einmal die neuesten Befunde aus Potsdam zusammen - und als ich das las, dachte ich: Wissenschaft muss nicht immer ans Licht der Öffentlichkeit.
Solches Zahlengeballer, das auf Modellierungen mit ständig höherer Rechenkapazität zurückgeht, bedeutet nämlich für das heutige Leben eines Lesers – überhaupt nichts. Kein Mensch, und sei er noch so zukunftsbewusst, würde sein Handeln an einem Horizont von mehreren Jahrhunderten ausrichten. Menschen sehen sich selbst und ihre Absichten im gelebten Generationenhorizont, also allerhöchstens im Rahmen eines Jahrhunderts. Auch wenn die Berechnungen wissenschaftlich durchaus Sinn machen, ist es ein Fehlschluss zu glauben, dass sie dann auch im Alltag, in der Lebenswelt Bedeutung haben müssten, ja sogar Folgen für das Verhalten hätten.
Menschen können wahre Abgründe zwischen Wissen und Handeln legen
Ein Kollege erzählte mir vor einigen Jahren die folgende Geschichte von einer Strandparty in den Düsseldorfer Rheinauen: Familien grillen, irgendwann machen ausgelassene Kinder ein Feuer. Schnell geht der Brennstoff aus, man macht sich auf die Suche. Nach kurzer Zeit schleppt ein Zehnjähriger eine große, verdorrte Tanne an, vielleicht ein weggeworfener Weichnachtsbaum. "Der brennt bestimmt super!" Er wirft ihn komplett ins Feuer, kurze Zeit später lodert, qualmt und stinkt es über den Strand. Zufrieden blickt der Junge in die Flammen. Und sagt die denkwürdigen Worte: "Sorry, Umwelt, das musste jetzt mal sein!"
Wovon erzählt diese kleine Geschichte? Eben davon, dass Umweltbewusstsein und Handeln nur entfernt miteinander zu tun haben können und davon, dass das Unbehagen, das mitunter entsteht, wenn man Dinge tut, die eigentlich falsch sind, ausgesprochen leicht zu bewältigen ist. Menschen können zwischen ihr Wissen und ihr Handeln Abgründe von der Dimension des Marianengrabens legen und haben nicht das geringste Problem damit. Schon der Zehnjährige weiß, dass Wissen und Handeln nicht zwingend
in Deckung gebracht werden müssen – es kommt im Gegenteil nur darauf an, dass man gute Begründungen hat, warum man etwas trotzdem tut, wenn Widersprüche auftreten.
Die Warnrufe aus der Wissenschaft sind längst abgenutzt
Und an dieser Stelle könnte man auch darüber sprechen, dass sich die Menschen zum Beispiel in Deutschland in einer Situation objektiver Schizophrenie befinden: denn sie sollen ja immer mehr kaufen, reisen, wegwerfen, damit die Wirtschaft weiter wachsen kann - und zugleich sollen sie sich wegen des Klimas und der anderen planetarischen Grenzen Sorgen machen. Beides zusammen ist logisch nicht kompatibel, aber zum Glück gibt es jede Menge Greentech-Produkte und Konsumstile, die diesen Widerspruch überbrücken – deshalb steht der Stadtgeländewagen so oft vorm Waldorf-Kindergarten und vorm Biomarkt.
Im übrigen sind die Warnrufe aus der Wissenschaft über nun vier Jahrzehnte abgenutzt und Teil von Normalkommunikation geworden. Man würde sich heute wundern, wenn es positive Meldungen von der Umweltnachrichtenfront gäbe. Der Aufmerksamkeitswert von Nachrichten vom Typ "Antarktisches Eisschild schmilzt schneller als erwartet" tendiert gegen Null. Teil des Problems ist überdies die falsche Annahme, negative Argumente könnten proaktive Handlungen motivieren. Das mag im Rahmen akuter Notfallsituationen funktionieren, aber nicht dann, wenn die Benutzeroberflächen der Konsumgesellschaften noch glänzen und zu funktionieren scheinen.
Lieber über den Nutzen für Menschen reden - statt über den Klimanutzen
Also gilt es, ganz woanders anzusetzen. Plakativ gesagt: Eine autofreie Stadt wäre auch dann gut, wenn es keinen Klimawandel gäbe. Warum fangen wir nicht an, proaktiv über die Umgestaltung unserer Wirtschafts- und Lebensweise zu reden und zu erzählen, wie wünschenswert und attraktiv Veränderungen wären? Bleiben wir beim Beispiel Stadt: Brauchen wir nicht gerade in Zeiten zunehmender digitaler Vereinzelung mehr öffentlichen Raum, der für Begegnung und Kommunikation zur Verfügung steht? Heute ist dieser öffentliche Raum von Autos und mehr noch von ihren Infrastrukturen – Straßen, Brücken, Kreisel, Ampeln, Parkhäuser usw. usf. – zugestellt.
Wäre es nicht schön, wenn stattdessen der sich bewegende Mensch zur entscheidenden Planungsgröße in der Stadt würde? Vom Absinken der Unfallrate über das Fehlen von Lärm und Abgasen und Blech bis hin zum Nutzen des Stadtraums zum Anbau von Obst und Gemüse wäre das in vielerlei Hinsicht ein positives Veränderungsprojekt. Und dass das ganze dann die CO2-Emissionen senkt, ein Kollateraleffekt, der gar nicht im Vordergrund steht.
Wir wissen inzwischen aus einigen Studien, dass es einen Primärnutzen geben muss, damit die Menschen im Sinne des Klimaschutzes handeln – im Idealfall, ohne es zu merken. Das beste Beispiel ist die Schweizer Bahn, die so komfortabel und praktisch ist, dass die Schweiz die geringste Quote an PKW-Nutzung aller vergleichbaren Länder hat. Kurz: Man muss etwas zu bieten haben, was eine Umstellung des eigenen Verhaltens attraktiv erscheinen lässt. Diagramme, Zahlen, Untergangsszenarien sind das sicher nicht, die kann man zur Kenntnis nehmen und sich, wenn es hoch kommt, davon die Laune verderben lassen. Dann steht schon die glitzernde Konsumwelt parat, um den Frust mit ein paar schönen Shoppingstunden zu vertreiben ...
Dieser Gastkommentar erschien zuerst in den DMG-Mitteilungen 02/2017. Wir veröffentlichen den Text mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft (DMG).