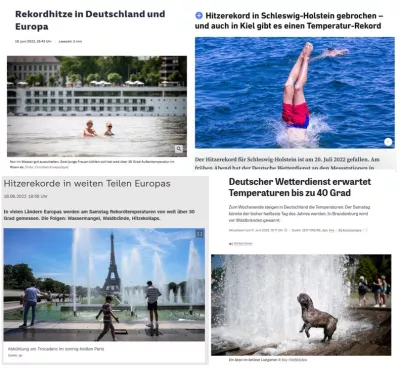Gefühlte Distanz ist laut Sozialforschern einer der Gründe, warum viele Menschen den Klimawandel nicht ernst nehmen: Sie glauben, er betreffe nicht sie - sondern irgendwelche Menschen in der Zukunft oder in Entwicklungsländern oder nur irgendwelche Pflanzen und Tiere, etwa die vielbeachteten Eisbären. Wie die Distanz zum Thema verringert werden kann, macht die New York Times mit einer großen Reportage aus Texas vor.
Reporterin Yamiche Alcindor stellt in ihrem Text unter anderem den 24-jährigen Adolfo Guerra vor, der als Gartenarbeiter sechs Tage die Woche für neun Stunden im Freien arbeitet. Eines Tages brach ein Kollege nach stundenlangem Rasenmähen in der Hitze zusammen, krümmte sich vor Krämpfen, übergab sich - andere Arbeiter schafften Eis heran, bedeckten ihn damit, und mit der Kühle erholte der Kollege sich schnell wieder. "Ich denke jeden Tag über das Klima nach", sagt Guerra. "Denn Tag für Tag fühlt es sich an, als ob es wärmer wird."

Mit zahlreichen, großformatigen Bildern der Fotografin Alyssa Schukar gibt die New York Times dem Klimawandel ein US-amerikanisches Gesicht; Foto: Screenshot/NYT
In der Tat zeigen Klimastatistiken, dass die Durchschnittstemperaturen im südöstlichen Texas in den vergangenen hundert Jahren bereits um rund ein Grad Celsius gestiegen sind - was moderat klingen mag, aber eine viel größere Wahrscheinlichkeit von Hitzewellen bedeutet. Gerade unter niedrig bezahlten Arbeitern hat Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl viele Stimmen hinzugewonnen - doch sein Versprechen, die Industrie und vor allem die Kohlebranche "wieder groß zu machen", ist für Menschen wie Adolfo Guerra eine direkte Bedrohung. Die zusätzlichen Treibhausgase machen für sie langfristig das Arbeiten immer gefährlicher.
Arme leiden besonders unter dem Klimawandel - auch in reichen Ländern
Der ärmere Teil der Bevölkerung, betont in der Reportage Robert D. Bullard, Professor an der Texas Southern University, sei vom Klimawandel besonders betroffen - und dies gilt eben nicht nur global gesehen, sondern auch innerhalb von Industrieländern wie den USA: Sie müssen zum Beispiel oft, wie Adolfo Guerra, auch bei großer Hitze im Freien arbeiten. Sie wohnen in schlecht isolierten Häusern, können sich hohe Stromrechnungen für Klimaanlagen kaum leisten und häufig auch keine Krankenversicherung. Überflutungen treffen sie ebenfalls am härtesten, wie schon Hurrikan Katrina 2005 in New Orleans zeigte.
Klimakampagnen hätten zu lange auf schmelzende Gletscher und Eisbären als Ikonen gesetzt, kritisiert Bullard. "Die Ikone sollte stattdessen ein Kind sein, das unter den negativen Folgen des Klimawandels und der Luftverschmutzung leidet oder eine Familie, deren Leben von ansteigenden Meeren bedroht ist."
Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Arbeitswelt beschreibt auch der Bericht Klimawandel: Was er für Arbeit und Beschäftigung bedeutet. Der gemeinsam von klimafakten.de und dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) herausgegebene Report fasst den Sachstand der weltweiten Forschung zu dem Thema zusammen.
ts