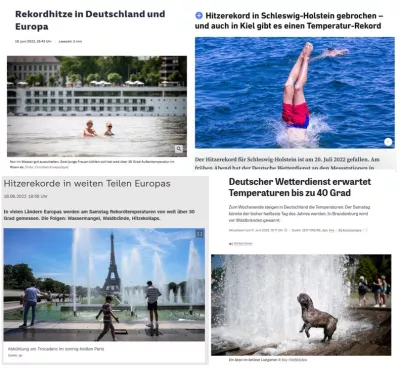Seit vielen Jahrzehnten schon beschäftigt sich die Wissenschaft mit dem Klimawandel – die Forschung zur Kommunikation über den Klimawandel jedoch ist relativ jung. Noch vor zehn Jahren, in den Jahren 2005 und 2006, erschienen pro Monat lediglich ein bis zwei Studien zum Thema. Inzwischen aber ist das Forschungsfeld kaum noch überschaubar – heute erscheinen Woche für Woche eine Handvoll von Untersuchungen zu Fragen, wie Medien weltweit oder in einzelnen Ländern über den Klimawandel berichten, was bestimmte Teile der Öffentlichkeit über ihn denken, welche Fotos zum Klimawandel beim Publikum welche Wirkung haben und so weiter.
Einen analysierenden Überblick über das Forschungsfeld gibt jetzt ein Artikel in der aktuellen Ausgabe des Fachjournals WIREs Climate Change. Autorin ist die kalifornische Geografin Susanne Moser, die selbst zur Klimakommunikation und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels forscht. Einen ähnlichen Überblick hatte sie bereits vor fünf Jahren vorgelegt. Damals schrieb sie, ein Großteil der Forschungserkenntnisse zur Klimakommunikation stamme aus benachbarten Wissenschaftsdisziplinen, etwa der Psychologie, der Risikoforschung oder der allgemeinen Kommunikations- und PR-Forschung. Nun schreibt sie, es gebe inzwischen "einen eigenen und wachsenden Stamm von Experten, die die irritierenden Herausforderungen erforschen, vor der eine wirksame Klimakommunikation steht".
Studien zur Klimakommunikationsforschung sehr weit verstreut
Doch die Forschungslandschaft sei schwer zu überblicken. Zum einen, weil sich die Zahl der jährlichen Publikationen seit 2005 mehr als verzehnfacht hat. Zum anderen erscheinen die Studien sehr weit verstreut – Moser zählte mehr als 400 Zeitschriften, die in den vergangenen zehn Jahren Arbeiten zum Thema veröffentlichten (zusammengenommen mehr als 1.200 Aufsätze). Die fünf wichtigsten Journale (Climatic Change, Environmental Communication, Global Environmental Change, Science Communication und WIREs Climate Change) kamen zusammen auf nicht einmal 20 Prozent der Veröffentlichungen. Bei vielen der anderen Zeitschriften handelt es sich um Nischenpublikation, ihr "Impact Factor" ist relativ klein (mit diesem wird erfasst, wie oft Studien eines Journals in anderen Studien zitiert werden, also wie stark sein Einfluss auf wissenschaftliche Debatten ist). Ein dritter Grund für die schwere Überschaubarkeit sei, dass die Klimakommunikationsforschung sehr interdisziplinär ist.
Doch jenseits der Unübersichtlichkeit des Feldes – was sind nun die zentralen Trends der jungen (Inter-)Disziplin? In den vergangenen hätten viele verschiedenen Entwicklungen die Kommunikation über den Klimawandel Jahren beeinflusst, rekapituliert Moser. Zu den Einflussfaktoren zählt sie erstens natürlich das Klima selbst (das sich zunehmend wandle und durch schwere Extremwetterereignisse ins Bewusstsein bringe), zweitens die Klimawissenschaft (sowohl durch einzelne Forschungsfortschritte als auch durch Meilenstein-Publikationen wie den Fünften IPCC-Sachstandsbericht, AR5), drittens aber auch politische Ereignisse (UN-Klimagipfel, die voranschreitende Energiewende, Aktionen von Umweltverbänden) oder viertens in der Klimakommunikation (die Umweltenzyklika des Papstes, öffentliche Klimaschutzkampagnen etc.). Auch beeinflusse – fünftens – die Klimakommunikationsforschung zunehmend die Praxis. Allerdings, so Moser, mangele es bisher an Untersuchungen, die direkt die Wirkung (und den eventuellen Erfolg) von Klimakommunikationsmaßnahmen messen. Sechstens schließlich dürften allgemeine gesellschaftliche oder politische Entwicklungen nicht übersehen werden, etwa Regierungswechsel in wichtigen Staaten oder Bedrohungen wie der islamistische Terrorismus, die öffentliche Aufmerksamkeit binden.
Gesicherte Erkenntnis: "Wir alle filtern Informationen zum Klimawandel"
Auch wenn noch viele Fragen offen seien, habe die Klimakommunikationsforschung zu einigen Themen mittlerweile relativ verlässliche Erkenntnisse erbracht. Etwa darüber, dass Menschen die Fakten zum Klimawandel sehr verschieden wahrnehmen: "Wenn wir Informationen [zum Klimawandel] hören, sie beurteilen, ihnen Sinn geben (seien sie gesprochen oder geschrieben, sei es visuell oder sensorisch), dann filtern wir sie – und zwar auf der Basis von Werten, die kulturell übertragen werden. Niemand kann diesem Einfluss entkommen. Wohl aber können wir uns seiner bewusst werden, und ihm versuchen entgegenzuwirken – wenn wir es denn wollen."
Diese individuellen Werteinstellungen beeinflussten nicht nur, fasst Moser den Forschungsstand weiter zusammen, wie wir das Klima wahrnehmen und interpretieren – und ob wir Ergebnisse der Klimaforschung gelten lassen oder nicht. Sie beeinflussen auch (und oft noch stärker), welche klimapolitischen Instrumente, welche technischen Lösungen und welche individuellen Verhaltensänderungen wir akzeptieren. "Klimakommunikation trifft also auf Widerstand oder auf Akzeptanz. Sie kann daher ansprechender für verschiedene Zielgruppen gemacht werden, wenn sie durch bestimmte Werterahmen an sie herantritt." Über dieses sogenannte "Framing" – also welche Deutungsrahmen welche Wirkungen erzielen – wird derzeit intensiv geforscht.
Während man früher davon ausging, dass eine bessere Vermittlung von Fakten zu mehr Klimaschutz führe (mangelndes Handeln wurde auf das Fehlen von Informationen zurückgeführt), ist die Forschung heute weiter, so Moser: "Zwar hat die Notwendigkeit nicht nachgelassen, Fakten zu erklären und die Öffentlichkeit zu bilden – doch Wissen allein genügt nicht, um zum Handeln zu motivieren. Und selbst für die motiviertesten Leute ist es alles andere als klar, was sie tun sollten." Die Vermittlung von Handlungsmöglichkeiten, so die verbreitete Einsicht, müsse deshalb "zentraler Teil jeder Klimakommunikation" sein – allerdings weniger "im Stil von Vorschriften, vielmehr sollten Optionen diskutiert werden". Menschen müssten "gangbare Wege sehen und das Gefühl haben, sich für sie entscheiden zu können".
Visuelle und erzählerischer Formate wichtig zur Vermittlung von Klimafakten
Zahlreiche Forschungsergebnisse liegen laut Moser auch über kommunikative "Hilfsmittel" vor, also über Datenvisualisierungen, Bilder und Bildsprache, Spiele und andere interaktive Kommunikationsformen. Zunehmend werde in der Literatur darauf hingewiesen, dass erzählerische Formate wichtig seien zur Vermittlung von Klimafakten. Zu all diesen Themen nennt der Aufsatz in Fußnoten jeweils wichtige Studien und weist so den Weg für eine tiefergehende Beschäftigung.
Zu den vernachlässigten Forschungsthemen gehört laut Moser die Klimaschutzbewegung und ihre Kommunikation. "Mit viel größerer Energie ist dagegen auf die Anti-Klima-Bewegung geblickt worden, auf das politisierte Umfeld für Klimakommunikation und insbesondere die Polarisierung rund um den Klimawandel, vor allem in den USA." Doch statt zu sehr auf Desinformationsversuche zu schauen, meint Moser, solle man sich stärker um jene psychologischen Abwehrmechanismen kümmern, mit denen "wir alle" auf den Klimawandel reagieren.
Hürden für Klimakommunikation: distance, doom, dissonance, denial, identity
In einer großen, zweieinhalbseitigen Tabelle fasst die Autorin dann zusammen, was in der bisherigen Forschung und wichtigen Sachbüchern) an Hürden für die Klimakommunikation identifiziert wurde: etwa die Wahrnehmung des Klimawandel als weit entfernt („distance“) und ohnmächtig machende Katastrophe („doom“), das Ausblenden unangenehmer Fakten („dissonance“) und das Bestreiten von Informationen („denial“), durch die man die eigene Identität infragegestellt sieht.
Am Ende des Aufsatzes nennt Moser schließlich eine Reihe von Aufgaben (sowohl für die Wissenschaft, als auch für die Praxis der Klimakommunikation): So solle man sich gezielt damit beschäftigen, wie Kommunikation in einer fragmentierten Medienlandschaft und bei polarisierten Öffentlichkeiten wirksam sein kann. Auch solle die mögliche Rolle von Kunst und Kultur, von Musik, Dichtung, Theater in der Klimakommuniaktion stärker betrachtet werden. Je mehr der Klimawandel sichtbar wird, desto drängender werde die Frage, wie man mit dem Gefühl von Überwältigung und Hoffnungslosigkeit umgehen kann. Und insgesamt, betont Moser, wäre ein besserer Rückfluss von Forschungsergebnissen in die Praxis wünschenswert.
tst