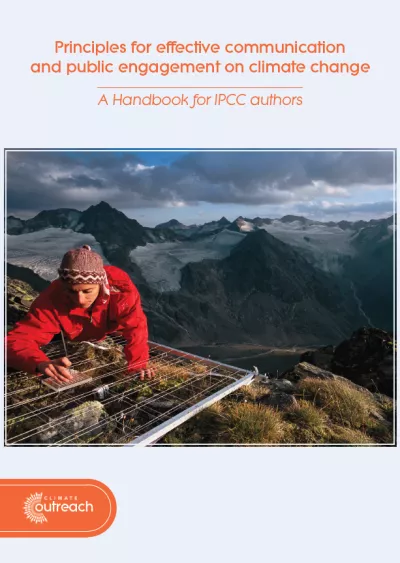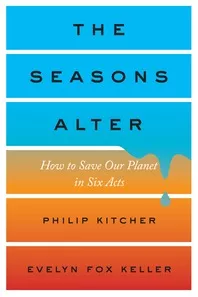Jeder ist für seinen Dreck selbst verantwortlich – dieses ethische Grundprinzip sollte nach Ansicht einer Mehrheit auch in der Klimapolitik gelten. Joachim Schleich vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe hat gemeinsam mit drei Kolleginnen und Kollegen im Frühjahr 2013 je tausend Menschen in China, Deutschland und den USA befragt. In jedem der drei Länder stimmten 60 bis 80 Prozent dem Prinzip zu: Je höher die Emissionen, desto mehr sollte ein Land für den Klimaschutz zahlen.
Die Umfrage ging zwar nicht ins Detail und fragte beispielsweise nicht, ob das Geld eher für emissionsarme Technologien oder zur Entschädigung bei Extremwetterschäden genutzt werden sollte. Doch die Botschaft der Bürger scheint klar zu sein: Eine gerechte Verteilung der Kosten des Klimaschutzes sollte sich in erster Linie an den jeweiligen Beiträgen zum Temperaturanstieg orientieren. Aber wären die Menschen auch bereit, tatsächlich selbst die Kosten zu tragen? Würde es sich also in der Klimakommunikation lohnen, an ihre Moral zu appellieren statt, wie oft üblich, vor allem an ihre Vernunft? Die vorläufige Antwort der Psychologie stimmt durchaus positiv: Menschen lassen sich häufig von der Moral leiten – aber nicht immer.

Ist es gerecht, dass Aschenputtel die von der bösen Stiefmutter verschütteten Erbsen aufsammeln und sortieren muss? Grimms Hausmärchen zeigen, dass schon kleine Kinder ein ziemlich genaues Gefühl für moralisches Verhalten und für die gerechte Verteilung von Verantwortlichkeit haben; Foto: Lippische Landesbibliothek Detmold
Ein aufschlussreiches Experiment stammt vom Politologen Thomas Bernauer von der ETH Zürich, der gemeinsam mit Kollegen jeweils zwei Probanden im Labor die internationale Klimapolitik simulieren ließ. Der eine Proband erhielt etwas Spielgeld und entschied, wieviel davon er für Klimaschutz ausgibt. Er musste sich sein Gebot gut überlegen, denn er konnte es später nicht mehr ändern. Der andere Spieler hatte dann die Wahl, das restliche Geld zuzuschießen – benötigt wurden insgesamt 30 Spielgeldeinheiten. Erschien ihm aber der Beitrag des ersten Spielers zu gering, konnte er das Geschäft auch platzen lassen. Dann erhielt der erste Spieler seinen Einsatz zurück, und es wurde gewürfelt, ob eine Klimakatastrophe eintritt und beide Spieler viel Geld verlieren. Je vermögender die beiden Teilnehmer waren, umso größer war in dem Experiment die Wahrscheinlichkeit einer Katastrophe, weil mit höherem Wohlstand auch die Emissionen stiegen. Bernauer fragte sich nun, ob es einen Unterschied macht, wenn die Probanden ihr Einkommen selbst nach oben setzen können (womit sich aber auch ihr Anteil an der Ursache des Klimawandels erhöht und letztlich das Risiko einer Klimakatastrophe). Fühlen sie sich dann auch stärker in der Pflicht und geben mehr Geld für Klimaschutz aus?
Heutiges Wohlstandsgefälle könnte ein stärkeres Argument sein als eigene Emissionen in der Vergangenheit
Die Probanden, die als erste ihr Gebot abgeben mussten, taten es nicht. Sie investierten zwar in den Klimaschutz, doch ihre Beiträge hingen nicht vom eigenen Vermögen und somit auch nicht von der eigenen Verantwortung ab, sondern vielmehr vom Spielpartner: Je weniger Geld der zweite Spieler besaß, desto mehr bot der erste. In diesem Experiment kümmerte es die Leute also nicht, wie sehr sie selbst zu Klimarisiken beitragen – doch die Probanden zeigten sich in einer Weise fair, mit der die Forscher gar nicht gerechnet hatten: Sie übernahmen mehr Verantwortung für den Klimaschutz, wenn ihr Partner schwach war. Bernauer sieht in den Ergebnissen deshalb eine Chance für die Klimapolitik: Bekanntlich entscheidet nach dem Weltklimavertrag von Paris jeder Staat eigenständig über seinen Beitrag zum Klimaschutz, und das Experiment gibt Hinweise für die politische Debatte darüber. Es legt nahe, dass es wenig bringt, an die Verantwortung für bisherige Emissionen zu appellieren – wohl aber an das Wohlstandsgefälle zwischen Staaten.
Lassen sich ethische Argumente für Klimaschutz also stärker in der politischen Debatte verankern? Die katholische Kirche jedenfalls sieht in ihnen einen starken Hebel, schreibt Armin Grunwald vom Karlsruher Institut für Technologie in seinem Buch über die päpstliche Enzyklika "Laudato Si". Diese nimmt nicht nur den Einzelnen in die Pflicht, sondern greift auch das System des Überflusses und der Gewinnmaximierung an. Ändern werde sich aber nur etwas, wenn die Bürger ihre Macht ausüben, schreibt Papst Franziskus und sieht einen indirekten Mechanismus: "Eine Änderung der Lebensstile könnte dazu führen, einen heilsamen Druck auf diejenigen auszuüben, die politische, wirtschaftliche und soziale Macht besitzen."

Die katholische Kirche und vor allem Papst Franziskus setzen in der Debatte zum Klimawandel stark auf moralische Argumente; Foto: Aletaia Image Department/Flickr
Doch sind die Einzelnen wirklich bereit, Verantwortung für ihren Dreck zu übernehmen? Man kann daran Zweifel haben. Zum Beispiel wird die Möglichkeit, den persönlich zu verantwortenden CO2-Ausstoß durch Investitionen in Klimaschutzprojekte zu neutralisieren, bisher nur selten genutzt. Als die Ökonominnen Anna Segerstedt und Ulrike Grote von der Universität Hannover deutsche Touristen auf Langstreckenflügen dazu befragten, lehnte eine Mehrheit die Kompensation ab. Aber auch hier kann man den Eindruck gewinnen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der moralischen und der ökonomischen Perspektive: Die Menschen könnten bei der CO2-Kompensation zögern, weil es aussieht, als wolle man sich einfach freikaufen - statt sich seiner Verantwortung zu stellen und daran zu arbeiten, den persönlichen Klimafußabdruck zu verkleinern.
Eine größere Verantwortung für eigenen Dreck – zumindest wenn er deutlich sichtbar ist
Darauf deutet ein Experiment von Michael Jakob vom Berliner Mercator Research Institute for Global Commons and Climate Change (MCC) hin. Gemeinsam mit drei Kolleginnen und Kollegen gab er Probanden eine Schüssel mit 300 Kichererbsen und sagte ihnen zehn Cent für jede Erbse zu, die sie in eine Schale in gut zwei Metern Entfernung werfen. In der vorgegebenen Zeit von vier Minuten trafen die Probanden durchschnittlich 21 Mal – der große Rest der Erbsen landete auf dem Boden und verschmutzte sozusagen die Umwelt. Anschließend gesellte sich ein Partner dazu, und das Forscherteam gab beiden Aufgaben am Computer zu lösen. Je mehr Aufgaben sie gemeinsam schafften, umso mehr Geld nahm jeder von ihnen mit nach Hause. Doch vorher mussten sie auch die Kichererbsen aufsammeln – sonst gab es gar nichts.
Weil die Aufgaben, die der erste Proband zu lösen hatte, doppelt so viel wert waren wie die Aufgaben des zweiten, wäre es finanziell sinnvoll gewesen, dass innerhalb der begrenzten Zeit der zweite das Labor aufräumt. Doch in 60 Prozent der Fälle entschied sich der erste dafür, die Erbsen aufzusammeln, bevor er sich an die Computeraufgaben machte. Er hatte den Dreck schließlich verursacht. Dem Team ging damit durchschnittlich ein Fünftel des Gewinns verloren. In einem Vergleichsexperiment, in dem die Erbsen schon zu Beginn vom Versuchsleiter auf dem Boden verteilt worden waren (der erste Proband sich also nicht dafür verantwortlich fühlen musste), wählten die Teams nur in 30 Prozent der Fälle - also halb so oft - die ökonomisch schlechtere Variante, in der Proband Eins den Boden säubert statt Proband Zwei.
Nun erfassen aber Kichererbsen gerade nicht, was den Klimawandel auszeichnet und zu einem so schwierigen Problem macht, gibt Michael Jakob selbst zu bedenken: dass er schwer zu greifen ist und seine Folgen weit in der Zukunft liegen. Das Laborexperiment zeigt also nicht zwingend, dass Menschen aus moralischen Erwägungen heraus ihren Lebensstil ändern würden, wie es Papst Franziskus fordert. Der Philosoph Dieter Birnbacher beschreibt in seinem Buch "Klimaethik" ebenfalls erhebliche Zweifel, dass Menschen zum Klimaschutz genügend motiviert sind, nachdem sie eingesehen haben, dass er nötig ist. Er schlägt vor, stattdessen nach Ersatzmotiven zu suchen, die stärker wirken und letztlich ebenfalls den Klimaschutz voranbringen.
Das Gefühl, stolz auf seine eigenen Leistungen sein zu können, fördert möglicherweise klimaschonendes Verhalten
Ein Ersatzmotiv könnte "das menschliche Bedürfnis nach übergreifenden Zielen" sein – zum Beispiel die Sorge um den eigenen Nachruf. Ein Team um die Psychologin Elke Weber von der Columbia University hat in einem Online-Experiment einen Teil der Teilnehmer daran erinnert, dass ihre Entscheidungen Folgen haben werden, die sie stolz machen könnten – die anderen Teilnehmer aber ermahnt, sie könnten sich später für die Folgen schuldig fühlen. Die einen wurden also an eine positive Verheißung erinnert, die anderen vor einem negativen Ergebnis gewarnt. Probanden aus der ersten Gruppe entschieden sich in einer Reihe fiktiver Handlungsoptionen häufiger für klimafreundliche Optionen als Probanden der zweiten Gruppe. Das Gefühl, stolz auf seine Leistungen sein zu können, fördert also möglicherweise den Klimaschutz.
Dazu passt auch eine internationale Umfrage eines Teams um den australischen Psychologen Paul Bain, in der Probanden gebeten wurden sich vorzustellen, dass der Klimawandel bis zur Mitte des Jahrhunderts erfolgreich bekämpft worden ist. Wie würde diese Welt aussehen? Diejenigen, die sich die Menschen in dieser möglichen Zukunft als ehrlich und moralisch vorstellten, waren auch eher bereit, Strom zu sparen und beim Einkaufen auf Nachhaltigkeit zu achten. Bei denjenigen, die sich eine Zukunft mit weniger Gewalt und Armut ausmalten, fiel dieser Zusammenhang deutlich schwächer aus. Paul Bain empfiehlt daher, die immateriellen positiven Nebenwirkungen des Klimaschutzes stärker zu betonen: vor allem die Aussicht auf eine fürsorglichere Gemeinschaft. Es könne sich also lohnen, eine positive Vision des Klimaschutzes zu entwickeln, der in eine Zeit führt, in der ethische Regeln stärker gelten.
Alexander Mäder