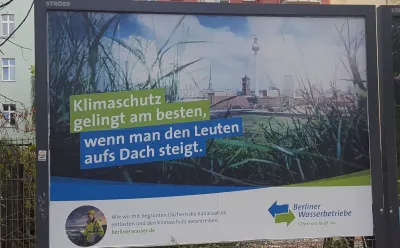2024 war ein Jahr der Extreme – und 2025 macht direkt weiter: Klimakatastrophen-Meldungen reihen sich (erneut) aneinander, genauso wie Katastrophen-Nachrichten aus Wirtschaft und vom Arbeitsmarkt. Nur ein paar Beispiele:
1,5 Grad: Wir reißen gerade die im Pariser Klimaabkommen festgesetzte Grenze zur globalen Erwärmung. Mit 2024 war erstmals ein gesamtes Jahr um 1,5 °C heißer als die vorindustrielle Welt. Auswirkungen dessen zeigen sich bereits deutlich: Hurrikane auf dem amerikanischen Kontinent, eine zerstörerische Flut in Spanien, die starken Winde und die monatelange Dürre in Kalifornien ließen Los Angeles brennen, und nicht zu vergessen die anhaltenden Dürren in vielen afrikanischen Ländern – die Beschreibungen dessen, was die Menschen aushalten müssen, lassen sich kaum mehr in Superlative steigern.
Stellenabbau: Die deutsche Automobilbranche und damit auch Zuliefererbetriebe und Unternehmen rund um die Produktionsstätten wie Bäckereien und Supermärkte stecken in der Krise. Im Herbst 2024 drohten bei Volkswagen ganze Standorte geschlossen zu werden, kurz vor Weihnachten dann die Einigung im Tarifstreit: 35.000 Stellen werden bis 2030 abgebaut, die Werke bleiben vorerst erhalten. Dennoch: Gewerkschaften, Betriebsräte und Beschäftigte sind wütend und fordern Zukunftsinvestitionen – angesichts der erheblichen Dividenden für die Aktionäre und die Gehälter der Manager*innen, die die Anpassung der Produkte an die E-Mobilitätsforderungen des Markts verpasst haben, ist das nur verständlich.
Klar ist: Die Auswirkungen der Klima- und Umweltkrise dürfte spätestens ab jetzt jede Person spüren. Unser menschliches Wirken auf das planetare System, der Kollaps unseres sensibel austarierten Klimas, der Verlust lebenswichtiger Biodiversität und der daraus entstehenden Probleme für unsere Ernährung und unsere Heimaten, stellt uns vor riesige Herausforderungen.
Existenzielle Job-Ängste scheinen dem existenziellen Klima-Anliegen gegenüberzustehen
Gleichzeitig spüren Beschäftigte aus verschiedensten Bereichen – Holz, Kunststoff, Automobil, ÖPNV, Tourismus, Chemie, Energie – die Auswirkungen der Klimakrise auf ihre Arbeit: Energiepreise sind in die Höhe geschossen, Rohstoffpreise explodieren, Arbeitsplätze verändern sich oder fallen ganz weg. Und das bei Jobs, die viele Jahre gute Löhne und eine sichere Perspektive versprachen.
Die Folge: Beschäftigte sorgen sich um ihren Arbeitsplatz. Und darum, dass sie sich ihren Alltag, ihre Wohnung und vielleicht auch einen Urlaub nicht mehr leisten können, dass sie in Armut geraten. Diese existenziellen Ängste stehen dem existenziellen Anliegen von Klima- und Umweltaktiven gegenüber – Wut, Unverständnis und Frustration sind die Folge. Rechtsextreme und rechtspopulistische Kräfte schüren und verstärken diese Emotionen und verbreiten Hass. An ein konstruktives Miteinander war lange nicht zu denken. Das „Betriebsklima“ verschlechtert sich.
„Am Ende ist das Problem nicht, dass jahrzehntelang Menschen ihrer Arbeit in der Kohlebranche nachgegangen sind, ihr täglich Brot verdient haben und ihre Familien ernährt haben. Das Problem ist, dass wir als Gesellschaft gemeinsam diese Energie verbrauchen und bisher noch keinen Weg gefunden haben, dies anders zu lösen.“
Natalie Gierse, Aktivistin bei Fridays for Future, hat (wie die Urheber der Zitate weiter unten) an der NELA-Zukunftswerkstatt teilgenommen
Auch wenn Gewerkschafter*innen als Interessenvertretung von Beschäftigten und Umweltaktive bereits konstruktiv zusammengearbeitet haben, z.B. beim Klimastreik und der gemeinsamen Aktion „Wir fahren zusammen“ von Ver.di und Fridays for Future, war die Gemengelage auch schon herausfordernd. Das war beispielsweise bei den Auseinandersetzungen zwischen Umweltaktiven und Beschäftigten der Kohleindustrie im Rheinischen Revier sichtbar, als parallele Aktionen von Klimaaktiven und Gewerkschaften stattfanden, Klimaaktivisten vor Beschäftigten der RWE im Hambacher Tagebau standen und es nicht nur Verständnis füreinander gab. Die gleichzeitigen Aktionen zeigen aber auch: Die Kraft lässt sich bündeln, wenn alle Beteiligten miteinander sprechen.
Sorgen ernst nehmen und miteinander sprechen
Wichtig ist daher, dass Menschen entsprechende Möglichkeiten finden miteinander zu sprechen. Sie müssen sich gegenseitig kennenlernen und die jeweils andere Meinung und Perspektive verstehen. Menschen, die sich für die nötige Klimawende einsetzen, müssen sich mit denjenigen austauschen, die der Transformation eher skeptisch und angstvoll gegenüberstehen, weil zum Beispiel ihr Arbeitsplatz von der Klimawende bedroht ist. So kann zum einen klar werden, dass es nicht darum geht, etwas wegzunehmen – sondern etwas zu schaffen: Es geht um eine sichere Zukunft in einem stabilen Klima für alle.
Zum anderen sind jene, die sich politisch für die Klimawende einsetzen, oft weit weg von der Lebensrealität der Beschäftigten in der Industrie. Dabei sind es gerade diese Arbeitnehmer*innen, die von den Veränderungen durch eine Klimawende direkt betroffen sind, zum Beispiel durch den Verlust oder die Veränderung von Arbeitsplätzen in energieintensiven Industrien (die überproportional häufig noch nach Tarif zahlen). Die konkreten Verhältnisse, Bedürfnisse und Arbeitsbedingungen vor Ort in den Betrieben sind Umweltaktiven selten klar. Doch es ist wichtig, diese Realitäten zu verstehen und anzuerkennen, um die konkreten betrieblichen Herausforderungen angehen und den Weiterbestand möglichst vieler und guter Jobs sichern zu können.
Austausch schafft Basis für Demokratie
Ein Raum, der einen solchen Austausch schafft, ist die sogenannte Zukunftswerkstatt. NELA. Next Economy Lab hat ihn für und zusammen mit Bildungsreferent*innen der Industriegewerkschaft Bergbau, Energie, Chemie (IGBCE) und Umweltaktive geschaffen. Im Frühjahr 2024 als Labor gestartet, ging es im März 2025 in eine neue Runde: Im Rheinischen Revier kammen erneut IGBCE-Vertreter*innen und lokale Umwelt- und Klimaaktive zusammen. Schon die Erfahrungen aus der ersten Veranstaltung zeigten, wie sehr sich solcher Dialog lohnt.
„Es gab kontroverse Diskussionen. Vertreter*innen der Umweltbewegung haben teilweise heftig auf Menschen reagiert, die im Bergbau arbeiten. Doch es ist Teil des Demokratiediskurses, Anspannungen auszuhalten und zusammen zu einem guten Ergebnis zu kommen.“
Günter Schnelle, freier Bildungsreferent für Arbeits- und Gesundheitsschutz IG Bergbau, Chemie, Energie (BCE)
Aber genau das ist eine Herausforderung, der wir uns als Gesellschaft stellen müssen: Es ist nicht wegzudiskutieren, dass es Zielkonflikte zwischen dem Erhalt bestimmter Arbeitsplätze und Umweltanliegen gibt. Aber eine Begegnung auf Augenhöhe ermöglicht es, diese Zielkonflikte offenzulegen, transparent zu machen und zu besprechen. Es geht nicht darum, immer einer Meinung zu sein oder zu werden. Es geht um Akzeptanz unterschiedlicher Perspektiven, eine differenzierte Betrachtung und Empathie – es geht um die Basis unserer demokratischen Kultur.
Raus aus der Komfortzone!
Dafür ist es notwendig, dass wir hin und wieder unsere eigene “Bubble” verlassen. In Zeiten von Social Media ist es gang und gäbe, dass wir nur Informationen und Perspektiven hören, die unserer eigenen Position sehr ähnlich sind. Dadurch werden wir uns fremd, und pauschale Feindbilder, die zum Beispiel von Rechtspopulist*innen gezeichnet werden, überwiegen im Diskurs.
Aber: In persönlichen Begegnungen können wir dieser Entwicklung etwas entgegensetzen. Es ist nicht alles schwarz oder weiß. Es gibt junge Menschen, die bei Fridays for Future aktiv sind und deren Eltern in der Industrie arbeiten. Es gibt Beschäftigte in der Autoindustrie, die auf Klimademos gehen. Es gibt Menschen, die früher bei Greenpeace aktiv waren und jetzt für eine Gewerkschaft arbeiten. Und wenn wir dies erkennen und es uns gelingt respektvoll miteinander zu sprechen, können sich Haltungen, Perspektiven und Meinungen verändern.

In der Zementproduktion – hier ein Werk von Heidelberg Materials – sind tiefgreifende Veränderung nötig, um sie klimaverträglich zu machen. Das wird nur gelingen, wenn Beschäftigte und Klimaaktive miteinander im Gespräch sind; Foto: Carel Mohn
Das zeigt auch die Erfahrungen aus der Zukunftswerkstatt: Menschen, die sich bisher eher aus dem Weg gegangen sind (im besten Falle) oder sich wüst beschimpften, haben miteinander gesprochen. Sie haben erkannt, dass es abseits vieler Konfliktpunkte auch einige wesentliche Gemeinsamkeiten gibt.
Denn abseits von Umweltpolitik gibt es oft viele andere verbindende politische Anliegen, wie Verteilungsgerechtigkeit oder die gemeinsame Verantwortung für unser Leben. Während engagierte Gewerkschaftsmitglieder und Funktionäre sich für das Wohlbefinden und eine gerechte Behandlung von Kolleg*innen einsetzen, übernehmen Umweltaktive Verantwortung für ökologische Belange: Dieses Engagement lässt sich verbinden! Wertschätzung für das Vergangene ist dabei die Basis für Offenheit in Veränderungsprozessen. Millionen von Menschen haben in den vergangenen Jahrzehnten in ihrer täglichen Arbeit ihr Bestes gegeben und dafür gesorgt, dass wir mit Energie versorgt werden. Das müssen wir als Gesellschaft würdigen.
„Die Klimabewegung kann viel lernen von den Gewerkschaften: Der Geist der Solidarität untereinander war beeindruckend. Ich habe erst in der Zukunftswerkstatt so richtig verstanden, wie die Gewerkschaftler*innen zusammenhalten. Solidarität ist so wichtig, wenn man etwas erreichen will.“
Carel Mohn, Mitgründer von Klimafakten
Am Ende wollen sowohl diejenigen, die in Chemiefabriken, bei Energieversorgern oder im Bergbau arbeiten, als auch jene, die sich für Umwelt- und Klimaschutz einsetzen, vor allem eines: sich für eine gute Zukunft für alle einsetzen.
Dafür müssen wir aufgrund der nicht-diskutablen Dringlichkeit der Klima- und Artenkrise uns die Frage stellen: Wieviel Energie brauchen wir und wofür? Wie können wir sie gewinnen, ohne die Krisen zu verschärfen und gleichzeitig sicherstellen, dass wir genügend und gute Arbeit für alle haben? Am Ende werden wir uns weiterentwickeln müssen. Wir müssen uns von Altbekanntem, das weder finanziell noch ökologisch vertretbar ist, verabschieden und eine neue Richtung einschlagen. Und dies können wir nur schaffen, wenn wir uns offen und ohne Vorwürfe begegnen.